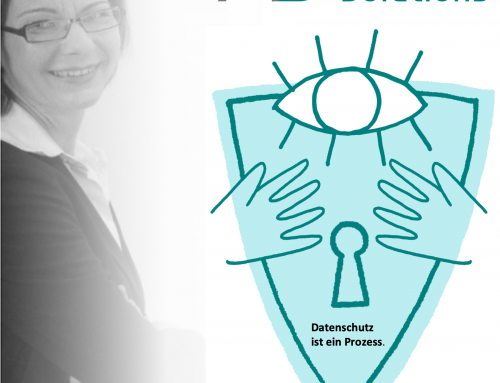Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet der Energiewirtschaft weitreichende Möglichkeiten: von der automatisierten Netzsteuerung über präzise Verbrauchsprognosen bis hin zur Optimierung dynamischer Tarife. Gleichzeitig stellen sich neue Fragen zu Transparenz, Sicherheit und Vertrauen. Die datenbasierte Steuerung kritischer Infrastrukturen bedingt klare Regeln für den Umgang mit Informationen. Dem Datenschutz kommt dabei eine zentrale Rolle zu – nicht als Hindernis, sondern als gestaltender Faktor für resiliente und akzeptierte Systeme.
Kritische Infrastrukturen als Risikozonen
Die Energieversorgung zählt zur kritischen Infrastruktur. Sie ist hochgradig vernetzt, komplex reguliert und zugleich sensibel gegenüber Störungen. Wo Datenflüsse zunehmen, entstehen neue Angriffspunkte: Manipulation, Zweckentfremdung oder Re-Identifizierbarkeit können nicht nur einzelne Betroffene, sondern auch die Systemstabilität insgesamt gefährden. Datenschutz darf in diesem Kontext nicht als bloße Compliance-Anforderung verstanden werden. Er ist integraler Bestandteil der Sicherheitsarchitektur und Grundvoraussetzung für gesellschaftliche und regulatorische Akzeptanz.
Datenschutz ist ein Gestaltungsprinzip. Er wird in der praktischen Anwendung jedoch häufig als Innovationshemmnis wahrgenommen, insbesondere in datenintensiven Projekten. Diese Perspektive erweist sich als unzulänglich. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beinhaltet ein praxisnahes und technologieoffenes Modell zur Strukturierung datengetriebener Prozesse. Ihre Prinzipien wie Zweckbindung, Datenminimierung und Rechenschaftspflicht fördern Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Qualität. Dies sind zentrale Anforderungen an vertrauenswürdige KI-Systeme. Der Datenschutz bildet somit das Fundament für eine verantwortungsvolle Gestaltung von Systemen und unterstützt die Skalierbarkeit von Innovationen.
In Anbetracht geopolitischer und ökonomischer Abhängigkeiten gewinnt auch die Frage der digitalen Souveränität an Bedeutung. Die Kontrolle über datenbasierte Technologien entscheidet in zunehmendem Masse über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gestaltungsspielräume. Der Datenschutz stellt in diesem Zusammenhang einen strategischen Hebel dar, da die rechtlich verbindliche Ausrichtung der Datenverarbeitung an europäischen Grundwerten ein Gegengewicht zur reinen Marktlogik schafft. Dies ist insbesondere im Kontext der Energiewirtschaft evident, die durch eine enge Verzahnung von staatlicher Steuerung, Marktakteuren und technischer Infrastruktur charakterisiert ist.
Smart Metering als sensibler Anwendungsfall
Ein konkretes Anwendungsbeispiel für die Verbindung von KI, Datenschutz und Energiewirtschaft ist das Smart Metering. Intelligente Messsysteme liefern hochfrequente Verbrauchsdaten, die zur Netzstabilisierung, Tarifoptimierung oder Steuerung dezentraler Einspeisung genutzt werden können. Gleichzeitig ermöglichen sie Einblicke in Alltagsgewohnheiten, beispielsweise in Bezug auf die Belegung von Haushalten oder den Betrieb von Geräten. Um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten und Vertrauen aufzubauen, sind Datenschutzmaßnahmen wie Zweckbindung, Speicherbegrenzung oder Pseudonymisierung daher unerlässlich.
Die aktuelle Verbreitung intelligenter Messsysteme in Deutschland bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften ist der Einbau intelligenter Messsysteme obligatorisch. Die aktuelle Ausstattungsquote liegt jedoch lediglich bei 2,2 Prozent. Im EU-Vergleich nimmt Deutschland damit den 27. Platz ein1. Die Ursachen sind in wirtschaftlichen und regulatorischen Hindernissen zu suchen, nicht im Datenschutz. Ein konsequent umgesetztes Datenschutzkonzept könnte die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz fördern und zur beschleunigten Einführung beitragen.
Rechtlicher Rahmen und neue Anforderungen
Der rechtliche Rahmen für die Datenverarbeitung in der Energiewirtschaft ist vielschichtig. Neben der Datenschutz-Grundverordnung gelten sektorspezifische Regelungen wie das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das BSI-Gesetz mit Schutzprofilen für Smart Meter Gateways sowie das IT-Sicherheitsgesetz mit Anforderungen an Betreiber kritischer Infrastrukturen. Ergänzt wird dieses Geflecht durch den in Kraft getretenen AI Act, der KI-Anwendungen im Energiebereich als Hochrisikosysteme einstuft. Unternehmen sind damit verpflichtet, nicht nur technische und organisatorische Schutzmaßnahmen umzusetzen, sondern auch angemessene Nachweiskonzepte zu entwickeln und gegebenenfalls Zertifizierungen vorzunehmen.
Der Datenschutz konstituiert an dieser Schnittstelle von Technik, Organisation und Recht den zentralen Integrationspunkt. Er verbindet regulatorische Anforderungen mit praktischen Umsetzungsstrategien und trägt zur Governance komplexer Systeme bei. In kritischen Infrastrukturen, wie beispielsweise der Energieversorgung, wird der Datenschutz damit zu einem strategischen Faktor. Dies ist nicht nur ein Mittel zur Risikominimierung, sondern auch ein Instrument zur Differenzierung am Markt.
In Kombination mit KI erlaubt der Datenschutz eine transparente, kontrollierte und wertgebundene Entwicklung datenbasierter Lösungen. Die Maßnahmen stärken das Vertrauen, sichern die Revisionsfähigkeit und schaffen somit die Grundlage für eine langfristige Akzeptanz. „Privacy by Design“ avanciert zum Qualitätsmerkmal intelligenter Systeme und wird zu einem wesentlichen Baustein für eine resiliente, digitale Energiezukunft.
Fazit: Vertrauen durch Datenschutz gestalten
Der Datenschutz umfasst ein breiteres Spektrum als lediglich die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Richtig verstanden und umgesetzt bildet er das Fundament für nachhaltige, innovationsfähige und gesellschaftlich akzeptierte KI-Systeme in der Energiewirtschaft. Er unterstützt die Systemtransparenz, schützt vor Missbrauch des Systems und fördert die digitale Souveränität. Die Implementierung von Datenschutz als integraler Bestandteil der Konzeption gewährleistet nicht nur die regulatorische Sicherheit, sondern auch das Vertrauen der Nutzenden, Partner und Aufsichtsbehörden. In kritischen Infrastrukturen ist dies keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Denn Datenschutz schafft Vertrauen.
1 CEO.Table – briefing table media, 31.05.2025